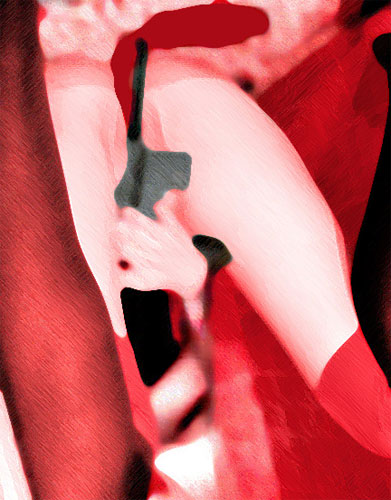Die Angst umfängt eine kleine Stadt, inmitten einer grauenvollen Zeit. Es ist April, und Alles geht zu Ende. Die Mörder streifen in den Nächten umher, Dirnen, Opiumsüchtige, Militärs und Aristokraten, tanzen auf dem Gipfel des menschlichen Verfalls. Inmitten des sich quälenden, windenden, sterbenden wilhelminischen Panoramas steht ein Haus, am Gipfel der Stadt. Jeder zweite Einwohner hat hier einen Vater, einen Sohn oder – nur aus Hunger – einen Säugling verloren. Die Stadt ist ruhig, doch der Geruch, der durch die kleinen Gassen geht, ist voller verdorbenem Fleisch und altem Urin auf nassem Stein. Das Haus, das hier steht und in dem auch ich wohne, ist ein Würfel aus Vergangenheit und dem Jetzt, Zukunft kann es hier keine geben. Denn die Zukunft ist ungewiss, so ungewiss wie die Pläne eines neuen Feindes aus Übersee.
Doch der Krieg ist in der kleinen Stadt ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen: Es fehlt hier an seinen Soldaten, Kanonen und Verwundeten. Der Krieg zeigt sich vielmehr in Gestalt einer Frau; sie ist immer noch so schön, wie Klimt sie malte. Es ist das Fräulein Mosbach aus der ersten Etage oberhalb der Toiletten, die da lebt, wo es immer so kalt ist.
Fräulein Mosbach zog in dem Jahr ein, als sich die Mächte spalteten und ihr Eisen aus den Fabriken zogen, um es in Richtung des Feindes zu schleudern. Sie ist, wie ich schon erwähnte, eine schöne Frau, lebte viele Jahre in Wien und verdingte sich als Modell in der Malerei – unter anderen bei Arwed Zimt und Franz Törkner. Doch die Malerei und alle Kunst verliert an Wert in Zeiten wie diesen. Und ihre Schöpfer verloren den Verstand: Sie meldeten sich freiwillig zum Sterben an die Front. Der Mosbach blieb nichts anderes übrig, als sich zurück in ihre Heimat zu begeben und sich als Dirne zu verdingen. Man hatte in der Nachbarschaft gemunkelt, sie sei eine Kinderdame der kaiserlichen Familie gewesen.
Sie fragen sich, was ich eigentlich bezwecke, warum ich überhaupt über eine Frau schreibe, die so ist, wie viele andere auch in dieser Zeit. Ich kann nur sagen, es ist meine Pflicht, zu berichten und Zeugnis abzulegen, über ein Ereignis hier in unserem Haus.
An einem Novembertag, es war sehr kalt und man vermutete, am nächsten Tag würde es schneien, kam der Postbote Herr Meistmann und gab ein Päckchen für das Fräulein Mosbach ab. Der Absender war das Heeresamt in Dresden-Strehlen. Da keiner aufmachte, hielt er für es besser, das Päckchen bei mir zu hinterlassen. Gegen Abend ging ich hinauf in die erste Etage und klopfte an die Tür des Fräuleins, doch es rührte sich nichts. Ich klopfte noch einmal; vernahm diesmal auch ein leises Knistern, doch die Tür blieb geschlossen. Ich drehte mich um, um hinabzusteigen, mit dem Vorsatz, später noch einmal mein Glück zu versuchen. Ich war schon auf halber Treppe, da ging die Tür der Mosbach einen Spalt weit auf. Eine zarte Stimme bat mich, das Päckchen vor die Tür zulegen, bedankte sich und die Tür wurde wieder geschlossen.
Ich tat wie mir geheißen. Dann ging in meine Wohnung und setzte mich mit meiner Frau Maria zum Abendbrot. Wir gingen früh zu Bett, denn Maria ging es nicht gut. Sie klagte über Schmerzen im Rücken. Ich zog es vor, ihr zu folgen und noch ein Buch zu lesen. Gerade als die Uhr zehn schlug, gab es oben im Haus einen dumpfen Knall, meine Frau schreckte auf und schaute mich an. Ich legte mein Buch zur Seite und ging zum Flur. Wissen sie, ich bin ein wenig schwerhörig und es fiel ir nicht leicht, festzustellen, was es für ein Geräusch das war und woher es kam.
Nachdem es aber in der Folgezeit still blieb, ging ich zurück zu meiner Frau. Sie bat mich, ihr ein Glas Wasser zu bringen. Als ich in die Küche ging, ertönte erneut dieser dumpfe Knall, doch diesmal heftiger und lauter. Unsere Katze sprang vom Ofen und schaute nach oben. Auf einmal hallte ein Schrei durch das Haus. Es war ein entsetzlicher Schrei, ein Schrei wie von einem Kinde. Aber irgendetwas sagte mir, das war kein Kind! Nein, dafür klang es einfach zu schauderhaft. Ich ging zu meiner Frau, beruhigte sie. Mir selbst pochte das Herz, doch ich zog meinen Bademantel über, ging zur Wohnungstür und öffnete sie vorsichtig. Im Treppenhaus brannte das Licht; es flackerte. Ich vernahm das leise Summen des Stromes, ansonsten herrschte absolute Stille. Ich ging hinaus und stieg vorsichtig die Treppe nach oben. Während ich langsam Stufe um Stufe erklomm, sah ich eine halb geöffnete Toilettentür. Es war die Tür zur Toilette des Fräuleins Mosbach. Ich bewegte mich langsam darauf zu und fragte mit leiser Stimme, ob sie da sei. Ich hörte keine Antwort und schaute noch einmal hinunter zu unserer Wohnung. Meine Frau und die Katze, die jetzt beide in der Wohnungstür standen, schauten mich an; in ihrem Blick lag Besorgnis. Doch meine Neugierde war zu groß und außerdem konnte ich nur helfen, wenn ich wusste was geschehen war. Ich nahm die letzte Stufe und griff nach der Toilettentür. Kurz warf ich einen Blick durch das Treppenfenster nach draußen, um mir noch einen Moment zu gönnen und auch, weil ich etwas Angst hatte, etwas zu sehen, was nicht gut war. Ich verharrte und beobachtete den Schnee, der auf die Aschetonnen fiel; ich blickte zum Himmel und konnte den Nordstern sehen. Dann sagte ich mir „Sei ein Mann und drehe dich um! Es wird gewesen nichts sein, was soll auch sein? Das ist nur der Wind und du bist nur ein alter hysterischer Mann.“ Doch was ich erblickte, ließ mich wünschen, ich wäre lieber meiner Angst gefolgt.
Ich hörte ich ein zartes Wimmern, das klägliche Weinen eines kleinen Mädchens, ein Flehen um Hilfe. Doch ich sah kein kleines Mädchen! Alles in meinem Kopf drehte sich, ich fürchtete, den Verstand zu verlieren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen: Ich bin hier und was ich sehe, geschieht tatsächlich. Das Fräulein Mosbach sitzt mit gespreizten Beinen nackt auf der Toilette. Das weiße Porzellan ist mit Blut verschmiert, ihr Unterleib ist getränkt in Rot, sie ist mit Fäkalien beschmiert. Ich schaue in ihr Gesicht, sie schaut mich ebenfalls mit großen Augen an. Sie ist blass, ihre schwarzen Haare bedecken leicht das Gesicht. Ein leises Stöhnen entfleucht ihrem Mund, meine Ohren vernehmen ein heftiges Atmen. Ich rufe meine Frau, sie soll Dr. Weisbach holen und nicht nach oben kommen. Meine Frau versteht, holt schnell ihren Mantel und läuft mit eiligen Schritten zu Dr. Weisbach. Ich fühlte mich so hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aus des Fräuleins Vagina schaut ein Gegenstand hervor. Ich begreife nicht, was ich sehe oder ist dies alles nur eine Illusion? „Lassen sie mich, ich weiß, es ist alles gut. Bitte machen sie sich keine Sorgen“, sagt Fräulein Mosbach mit aufgeregter aber leiser, fast schon zischender Stimme. „Bitte, gehen sie! Mir geht es gut“.
Mir läuft ein Kribbeln durch den Kopf. Ich kann nicht glauben, was sie sagt; ich kann nicht ertragen, sie so zu sehen. Als ich jedoch näher trete, um ihr meine Hand hinzustrecken, fängt sie an zu schreien. Ich schrecke zurück, bin völlig aufgeregt, sehe auf ihren Oberkörper, mich packt Entsetzen. Ihre Brüste sind aufgeschnitten, keine tiefen Schnitte doch sicher schmerzhaft und wild blutend. Seit der Front habe ich nicht mehr so Entsetzliches gesehen. Und noch etwas anderes fiel mir jetzt auf. Es stank, es stank nach Exkrementen. Ich versuchte Herr meiner Sinne zu bleiben und sprach das Fräulein leise an, fragte sie, was geschehen sei. Sie hob ihren Kopf und schaute mich mit einen bohrenden Blick an: „Wir alle verlieren unsere Unschuld. Wir haben uns versündigt. Gehen sie! Morgen ist alles wieder in Ordnung“. Ich fühlte mich völlig hilflos und betete darum, dass meine Frau und Dr. Weisbach kopmmen mögen. Ich schaute die Treppe hinunter. Auf einmal ging das Licht aus. Ich zuckte zusammen, fühlte mich schlagartig wie ein kleiner Junge allein im Keller. Ich fragte noch einmal, ob alles in Ordnung sei. „Warum fragen sie?“, kam ihre Antwort. „Sie haben Angst. Angst vor dem, was sie nicht begreifen können, sie sehen und sie verstehen nicht“. In mir stieg Wut auf, die sich mit meiner Hilflosigkeit mischte. Anscheinend war sie nicht das Opfer eines Verbrechens geworden. Ich glaube, das einzige Verbrechen, das hier geschah, lässt sich nicht benennen, denn es würde nie erklärbar sein. Alles was Böses geschah im Krieg, war böse, doch das kann ich nicht erklären, weder mir noch ihnen.
Dann kam meine Frau mit Dr. Weisbach. Der Arzt erlitt einen Ohnmachtsanfall und brauchte eine Weile, um sich wieder seiner Sinne zu bemächtigen. Das Fräulein lachte leise und summte vor sich hin, ohne erkennbare Melodie. Der Doktor gab ihr eine Spritze, untersuchte und versorgte sie. Er bemühte sich, diesen Gegenstand aus ihrem Unterleib zu entfernen. Dabei zeigte das Fräulein keine Regung. Sie starrte an die Decke, sie wirkte abwesend, als sei nur ihr Körper hier, sie selbst aber weit weg. Wir alle sind weit weg.
Wir trugen sie in ihre Wohnung und wuschen sie, meine Frau machte ihr Bett, der Doktor gab ihr noch eine Spritze und wir blieben an ihrem Bett sitzen. Ich begleitetet den Arzt zur Tür und wir schwiegen uns an. Er gab mir den verfluchten Gegenstand, eingewickelt in Zeitungspapier und flüsterte mir ins Ohr: „Was wir hier gesehen haben, können wir niemanden erzählen. Es wird etwas kommen und es wird schrecklich werden. Passen sie auf sich und ihrer Frau auf und verlassen sie zur richtigen Zeit das Land.“ Ich fragte, was mit Fräulein Mosbach geschehen würde. Er schaute mich an und meinte nur, dass sie schon wieder wird. Sie sei opiumsüchtig, das wäre alles. Er drehte sich um und ging.
Ich ging in Fräulein Mosbachs Wohnung und fasste meiner Frau an der Schulter, sie legte gerade ein nassen Lappen auf des Fräuleins Stirn. Wir blieben die ganze Nacht bei ihr. Meine Frau schlief kniend vor dem Bett, ich saß auf dem Fußboden. Ich nahm den Gegenstand und wickelte ihn aus. Es war eine Pistole, eine deutsche Militärpistole. Ich sah zum Bett. Das Fräulein war wach und beobachtete mich uns sagte: „Sie ist anscheinend kaputt. Sie gehörte meinen Verlobten, er erschoss sich damit. Es ist das Einzige, was mich an ihn erinnert“. Ich schaute sie an, meine Frau wachte auf und war offensichtlich froh, dass es dem Fräulein wieder besser ging. Sie nahm ihre Hand und sagte, sie könne immer zu uns kommen, wenn sie einsam sei, die Tür stehe immer offen. Das Fräulein sah zum Fenster, die Morgensonne schien ihr ins Gesicht. Sie lächelte, ich nahm meine Frau in die Arme. Wir drehten uns um und gingen hinaus. Das Fräulein rief uns mit benommener Stimme hinterher: „Meta ist mein Name“. Ich blickte über meine Schulter nickte ihr zu.
Ja liebe Leser das war meine Geschichte, eine der Geschichten in diesem Haus, wie viele andere auch, die in einen Haus passieren.
Heinrich Grünmann
am 09 November 1916,
Irgendwo in einer Stadt.
Ende Teil 1